Woran erkennt man starke Protagonistinnen? Was zeichnet Stärke aus? In der Diskussion rund um Bücher oder Filme werden gern „starke weibliche Rollen“ angepriesen. Auf der Kinoleinwand sind damit oft kämpfende Heldinnen gemeint, manchmal mit Superkräften, die sich dem Bösen entgegen stellen und Männern in nichts nachstehen. Doch manche machen den Fehler, männliche Heldenrollen weiblich zu besetzen, und das – nun ja – hilft auch niemandem.
Starke Rollenvorbilder sind wichtig: Ich bin selbst mit Zeichentrickserien der 80er und 90er aufgewachsen, in denen weibliches Heldentum oder weibliche Repräsentation noch sehr stereotyp war. Im heutigen Essay mache ich mir ein paar Gedanken über das Schlumpfine-Syndrom, den Bechdel-Test und wie weibliche Heldinnen sein sollten, um nicht nur Helden mit Brüsten zu sein.
Inhalt

Heldinnen der 80er und 90er Jahre: Das Schlumpfine-Syndrom
Bei den Schlümpfen gab es in den ganz alten Folgen überhaupt keine Frau. Erst in den späteren Staffeln kam Schlumpfine dazu und nach ihr ist direkt das Schlumpfine-Syndrom benannt, das das folgende Stereotyp bezeichnet: Nämlich wenn nur eine Frau auf ein ansonsten männliches Ensemble trifft. Ihre einzige Eigenschaft ist in der Regel, dass sie weiblich ist.
Dieses Prinzip trifft auf nahezu JEDE Kindersendung zu, die ich als Kind gesehen habe. Aus dem Kopf fallen mir ein: Sabor Rider und die Starsheriffs, Galaxy Rangers, Gargoyles, die Muppet Show, die Ghostbusters, Teenage Mutant Hero Turtles, Peter Pan und viele weitere. Auch bei den 5-Freunde-Büchern von Enid Blyton (, die auch aus anderen Gründe proplematisch sind, weil sie misogyn und rassistisch sind), haben wir Anne als einziges Mädchen, da George sich ja nun als Junge betrachtet. Anne ist dafür doppelt weiblich und nur am Haushalt interessiert. Bei TKKG gab es mit Gaby, die eine auffällige Ähnlichkeit zu Schlumpfine aufweist, auch nur ein Mädchen in der Detektiv-Gruppe.
Die Frauenforschung hat das Thema hinlänglich erforscht; ich werde das hier nicht alles wiedergeben, keine Sorge. Mir geht es darum, die Problematik bewusst zu machen: Die Schlumpfines dieser Serien waren ja wichtig in dem Sinne, dass da überhaupt Mädchen waren.
Ich erinnere mich, dass ich als junges Mädchen die männlichen Rollen besser fand, weil die meist viel besser kämpfen konnten, doch als Identifikationsfigur blieb dann immer nur das Mädchen, das keinerlei Individualität aufwies und in erster Linie hübsch war. Sie waren selbst innerhalb dieser Kämpfergruppen nicht gleichberechtigt, sondern waren dann meist für die Kommunikation zuständig (April bei den Starsheriffs) oder verfügten über mentale Fähigkeiten (Niko bei den Galaxy Rangers) oder waren gar nicht Teil der Kampftruppe (Janine bei den Ghostbusters oder April bei den Turtles; auch April von den Starsherriffs und Niko von den Galaxy Rangers waren meist in der Kommandozentrale und steuerten die Kommunikation, statt am Kampfgeschehen teilzunehmen). Zum Vergleich: Die männlichen Mitglieder der Truppen hatten z.B. einen Superarm, oder sie konnten sich krass verwandeln und hatten Superkräfte. Den Damen blieb der Job als Telefonistin und wenn sie in Kampfhandlungen involviert waren, dann, um beschützt oder gerettet zu werden.
Wie geil fand ich es, dass Prinzessin Leia (noch eine Schlumpfine zwischen Han Solo, Luke, C3PO, R2D2 und Chewie) dann wenigstens zur Waffe greifen und sogar schießen durfte! Zum Jedi hat es bei ihr trotzdem nicht gereicht – das wurde dann Jahrzehnte später leicht korrigiert und wir haben mit Rey und Ahsoka endlich weibliche Jedi, aber in den 70ern/80ern waren wir da noch weit von entfernt.
Starke Protagonistinnen oder roboterhafte Heldinnen? Weibliche Stereotype und Bechdel-Test
Von den Stereotypen der 80er/90er-Serien haben wir uns glücklicherweise verabschiedet, aber noch immer ist die Darstellung und Repräsentation weiblicher Rollen mit Stereotypfallen konfrontiert und auch ich ertappe mich immer wieder, dass ich weibliche Stereotype in meinem Schreiben reproduziere, statt sie aufzubrechen – schön ist, wenn man es wenigstens noch merkt ;).
Ein Stereotyp, das gewissermaßen als Gegenentwurf zu Schlumpfine entstanden ist, aber leider in dieselbe Falle tappt, ist das Pick-Me-Girl: Sie ist einfach anders als alle anderen Mädchen und Frauen und deshalb der beste Kumpel des ansonsten männlichen Ensembles. Sie ist bewusst keine Schlumpfine und lehnt alles Weibliche ab. Man spricht von internalisierter Misogynie: Frauen, die Frauen und alles Weibliche hassen und demzufolge abwerten.
Nennen wir sie George oder Georgina, denn Enid Blytons Figur verkörpert das Pick-Me-Girl perfekt. Sie hat die Misogynie so sehr verinnerlicht, dass sie alles Weibliche ablehnt und abwertet. Aus frauenhistorischer Sicht sind die Pick-Me-Girls einfach eine Katastrophe, weil sie den Zusammenhalt unter Mädchen durch den verinnerlichten Frauenhass unmöglich machen.
Die Erkenntnis darüber und das Aufbrechen dieser Muster geschieht nun schon seit einigen Jahrzehnten, doch noch immer merke auch ich beim Schreiben, dass ich aufpassen muss, um das nicht zu reproduzieren. Auch in Filmen und Büchern besteht die Gefahr, statt einer wirklich starken, weiblichen Figut einen weiblichen Charakter mit männlichen Eigenschaften auszustatten. Das Ergebnis ist dann eine Art roboterhafte Heldin, sowas wie Lara Croft, die obendrein zum Sexobjekt stilisiert wurde – entsprechendes Pornomaterial ist in ausreichender Weise frei im Internet verfügbar.
Der Bechdel-Test
Es gibt einen Test, den man sehr einfach auf jeden Text und Film und Serie anwenden kann, den Bechdel-Test, der aus den folgenden drei Fragen besteht:
- Gibt es mindestens zwei Frauenrollen?
- Sprechen sie miteinander?
- Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann?
- Zusatzfrage: Haben sie beide Namen?
Anhand dieses Tests lässt sich die Schlumpfine-Pick-Me-Girl-Problematik weitgehend umschiffen. Er hilft natürlich noch lange nicht, wenn wir dem Ganzen weitere Dimensionen hinzufügen wie die Repräsentation von Behinderten, People of Colour oder Queeren, aber dieser Test ist ein guter Anfang und er ist sehr wirkungsvoll. Er bringt auch moderne Geschichten ins Schleudern, wenn wir z.B. feststellen, dass Gamora bei den Guardians of the Galaxy im ersten Teil noch wesentliche Merkmale des Pick-Me-Girls erfüllt, oder auch Black Widow gerade in ihrer Anfangszeit bei Marvel eine aus feministischer Sicht schreckliche Rolle verkörpert, die doch sehr viel von Bondgirl hat. ( A propos Bond und weibliche Rollen – ach, lassen wir das lieber, ich mochte Bond noch nie. Ich denke, du kannst dir selbst ein Bild machen ;).)
Klischeefallen für weibliche Rollen: Damsel in Distress und andere
Es lauern noch viele weitere Klischeefallen für weibliche Stereotype. Ich erwähnte eben schon das Gerettetwerden von Frauen durch jahrzehntelange Fernsehgeschichte. Ob es mit Tarzan und Jane begonnen hat, weiß ich nicht, aber das Prinzip war lange genau das: Der Trope dazu heißt damsel in distress, zu deutsch Jungfer in Nöten und gilt für Feminist:innen heute als red flag, wenn er so klassisch wie bei Tarzan und Jane umgesetzt wird (looking at you, Spiderman).
Ehrlich gesagt ist daran auch nichts mehr spannend, oder? (Zum Thema Tropes empfehle ich dir diesen Artikel, wo es um Tropes, Stoffe und Motive geht.)
Aber was macht nun eine starke Heldin aus?
Auf Instagram habe ich neulich ein wunderbares Zitat gefunden, das ich als Antwort auf diese Frage geben möchte. Sie ist gültig für alle Heldinnen und Helden und, wie ich finde, das Fundament aller guten Protagonisten – egal welchen Geschlechts, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Identität:
Verletzlichkeit ist nicht das Gegenteil von Stärke. Sie ist ihre Voraussetzung.
Brené Brown
Diese Aussage ist meiner Erfahrung nach wahr für Menschen und für literarische Figuren. Sie trifft auf alle meine Protas zu, denn sie alle sind erfüllt von Ängsten und/ oder haben etwas zu verlieren – das ist es, was uns verletzlich macht, aber auch Kraft gibt.
Verletzlichkeit wird traditionell mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht. Das Patriarchat hat uns gelehrt, dass das etwas ist, das wir überwinden müssen, dass Verletzlichkeit und Weiblichkeit schlecht sind. („Indianer kennt kein Schmerz.“) Das hat soziokulturell natürlich verheerende Folgen für Frauen, aber auch für Männer, von denen ein Auftreten wie von einem He-Man oder Terminator gefordert wird: Roboterhafte Männlichkeit. Auch heute noch treten solche Typen gerne als Bad Boy auf. Als solche beginnt zumindest die Fassade des harten Kerls zu bröckeln. Man darf gespannt sein, was sich daraus noch entwickelt.
Ich denke nicht, dass es viele weitere Eigenschaften oder Merkmale braucht, um eine „starke“ Figur zu schreiben. Nur weil sie ein Schwert führen kann, muss eine Figur nicht stark sein. Oder nur, weil sie kein Schwert führt, muss sie nicht schwach sein.
Ich mag Figuren, deren Stärke aus ihrem Inneren kommt und vielleicht auch mit der Zeit wächst oder erst entdeckt wird. Deshalb ist es auch egal, ob die Heldin eine Kriegerin oder eine Köchin ist, eine Mutter, einer Hure, eine Geliebte (um mal die klischeehaftesten role models anzuführen): Es kommt immer drauf an, was in ihnen steckt und wie sie sich im Lauf der Geschichte entwickelt. Meine drei wichtigsten Heldinnen stelle ich in diesem Artikel vor.
Weibliche Heldinnen sind nicht so viel anders als männliche. Als Autor:in fühlen wir uns in unsere Charaktere ein, erschaffen eine Biographie, Charaktermerkmale, körperliche Eigenheiten und Merkmale, aufgrund derer sich ein Bild der Person entwickelt. Wer es schafft, seine Figur von innen heraus zu modellieren anstatt sie nur von außen zu sehen, erschafft lebendige Figuren. Manch eine mag auch zum Held oder zur Heldin werden.
Quellen
Bechdel-Test: Wikipedia, abgerufen am 26.3.2025
Das Schlumpfine-Prinzip: Wikipedia, abgerufen am 26.3.2025
Galaxy Rangers: Wikipedia, abgerufen am 26.3.2025


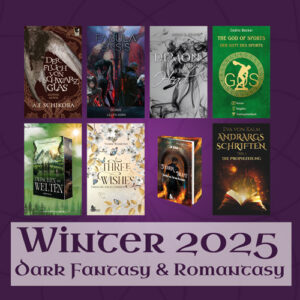
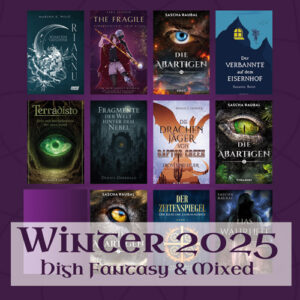
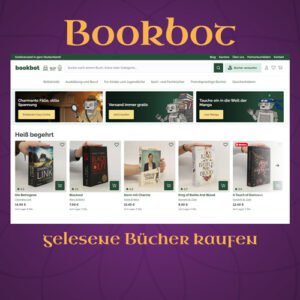



2 Gedanken zu „Starke Protagonistinnen: Heldinnen ohne Stereotype?“