Hast du dich schon einmal dafür geschämt, Geld für deine Kunst zu verlangen, oder warst verlegen, ob der Preis „angemessen“ ist? Warst du schon einmal verlegen, weil du irgendwie zur Sprache bringen wolltest, dass dein Auftritt nicht kostenlos ist? In diesem Essay lade ich dich ein, gemeinsam mit mir zu erkunden, warum wir Kunst und Künstler:innen sowohl mit Ehrfurcht als auch mit Verachtung begegnen.
Künstler und Geld haben seit eh und je ein schwieriges Verhältnis. Schließen sich Kunst und Geldverdienen gegenseitig aus? Gibt es ein Gesetz, das besagt, man müsse als Künstler:in arm sein? Kunst ist nur Kunst in Verbindung mit Armut, aber nicht mit Kommerz? Und wenn jemand kommerziell erfolgreich ist, hat er oder sie „nur eine clevere Idee zu Geld gemacht“ und der künstlerische Aspekt tritt in den Hintergrund? Wo liegt da die Grenze? Und warum bezahlen Menschen Millionen Dollar für eine an die Wand getapte Banane oder eine unsichtbare Skulptur? (Sollte ich mein Geschäftsmodell überdenken?)
Der Konflikt zwischen Kapitalismus und Kunst ist unübersehbar, und natürlich treibt er mich um, denn ich möchte meine Kunst in Form von Büchern verkaufen. Im heutigen Essay aus der Kategorie Autorenleben mache ich mir Gedanken über das liebe Geld und brotlose Kunst und habe viele Fragen.
Inhalt
Über die Seele der Kunst
Was bedeutet es, Künstler:in zu sein? Welchen Stellenwert hat Kunst heutzutage noch, wo ich sie doch per Prompt ins Internet schmieren kann? Und ab wann bin ich Künstler:in? Wenn man meine Kunst kaufen kann? Oder wenn ich meine Kunst erfolgreich verkaufen kann? Wie viel Geld muss ich mit meiner Kunst einnehmen, um ernst genommen zu werden?
Und ist Kunst nur dann „gut“, wenn sie sich kommerziell erfolgreich vermarkten lässt? Was ist mit der Kunst, die nur ein kleines oder gar kein Publikum findet?
Ich werde nicht alle Fragen beantworten können, die mir zu diesem Thema einfallen, denn die übergeordnete Antwort ist die: Es hat viel mit einem selbst zu tun. Was sehe ich in einem Werk – sei es ein Musikstück, ein Bild, ein Text, eine Installation? Was sehe ich, wenn ich es betrachte oder konsumiere, und was hat der oder die Künstler:in hineingegeben?
Ist das Kunst, oder kann das weg?
Spruch
Künstler:innen sind unsichere Menschen.
Wir zweifeln an uns und unserer Kunst. Nicht wenige Künstler:innen bringen psychische Probleme mit. Nicht umsonst wenden sich Menschen in persönlichen Krisensituationen an die Kunst – weil sie Trost in der Kunst suchen, oder sie werden selbst künstlerisch aktiv, um sich selbst Trost zu spenden.
Das ist vielleicht das ganze Geheimnis: Trost.
Künstler:in und Kunstwerk gehen in diesem Schaffensprozess eine enge Bindung ein – I can tell!
Es ist eine heilige Beziehung, etwas, das ich besonders im Anfangsstadium schütze, weil dieser Teil des Schaffens sehr vulnerabel ist. Erst nach und nach war ich bereit, die entstehende Kunst mit anderen zu teilen. Im direkten Gespräch kostet es mich immer noch Überwindung. Nicht, weil ich mich in einem permanenten Zustand mentalen Überlebens befinde, sondern weil man sich selbst angreifbar macht.
Jeder Satz und jede Figur enthält einen Schatten meines Schmerzes – meiner Seele, wenn man so will. Und den kann ich wiederum nur ertragen, indem ich meine Kunst erschaffe: Das Darkadium.
Meine Tochter malt und kritzelt ständig. Wann immer ich an ihr vorbeigehe und auf ihr ipad schiele, verdeckt sie es oder klappt es um, damit ich nicht gucke. Ich kann es selbst nicht haben, wenn mir jemand beim Schreiben über die Schulter guckt. Ich hab es schon in der Schule gehasst, etwa bei Klassenarbeiten, aber auch im Berufsleben und natürlich beim Schreiben.
Kunst zu erschaffen ist ein intimer Vorgang für Künstler:innen und später dann für die Betrachter:innen. Es entsteht eine Bindung zwischen beiden über das Werk, die Zeit und Raum überbrückt.
Sollte man nun diese intime Bindung, diesen Prozess des Erschaffens mit so etwas Profanem wie Geld entweihen? Der Künstler oder die Künstlerin erschafft ja sowieso, weil etwas in ihr drängt. Entwürdigt Geld nicht die Kunst? (Behalte den Gedanken im Hinterkopf!)
Müsste „gute Kunst“ nicht brotlos sein?
Dir kann Kunst egal sein und du kannst Künstler:innen als Schmarotzer betrachten, aber wenn dein Vater oder deine Mutter stirbt oder dein Kind oder dein Hund, oder wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, dann stehst du an einem Abgrund und brauchst plötzlich etwas.
Es gibt Momente, in denen ist eine Rose wichtiger als ein Stück Brot.
Rainer Maria Rilke
Es muss gar nicht so dramatisch sein: Hättest du die Coronakrise ohne Musik oder ohne Bücher überstanden?
Kunst bedeutet und bringt Authentizität. Und das ist der schwerwiegendste Kritikpunkt, den man der KI entgegenbringen muss: Ihr Output ist nicht authentisch. Der Output hat keine Seele, aber genau das ist es, was die Menschen brauchen. Das ist das, was die Bindung herstellt, den Seelenschatten der Künstler:in.
Kunst ist vielleicht die letzte Bastion in einer durchkapitalisierten und digitalisierten Welt – kein Wunder, dass der Kapitalismus versucht, die Kunst zu korrumpieren. Und wer sich nicht vom Kapitalismus vereinnahmen lässt, wird diskreditiert und verachtet. In einer kapitalistischen Welt wird nur die Künstler:in anerkannt, die kommerziell erfolgreich ist. Und wir haben das so verinnerlicht, dass wir als Autor:innen uns selbst zerfleischen, während wir den Bestseller anpeilen. Wir verachten uns selbst, wenn wir die finanziellen Ziele nicht erreichen.
Wenn man diesem Gedanken folgt, muss man sich fragen, ob man im Umkehrschluss seine edlen, künstlerischen Absichten mit dem kommerziellen Erfolg verrät? Bin ich noch Künstlerin, wenn ich gut verkaufe, oder bin ich dann eine erfolgreiche Geschäftsfrau?
Diesem Teufelskreis, der auch ziemlich unfair ist, kann man kaum entkommen.
Authentizität und Verkaufsdruck
Das Kunst-Erleben ist unsichtbar. Du kannst es nicht anfassen und nicht essen, aber du kannst einen Mangel erleiden. Wir lesen in der Zeitung von einer Krise der Einsamkeit, die besonders junge Männer betrifft, von einem Empathieverlust, die Gesellschaft driftet nach rechts — und niemand erkennt den Zusammenhang?
Künstler:innen und Kulturschaffende gelten als etwas Überflüssiges, das weg kann. „Der brotlose Künstler“ hat es zum Stereotypen geschafft. Das ist wichtig zu erwähnen, denn dieses Stereotyp ist auch ein Glaubenssatz, den wir alle irgendwie stillschweigend hinnehmen, so als sei er ein Naturgesetz. So als sei der zuvor skizzierte Teufelskreis real.
Dass Künstler:innen finanziell schlecht dastehen, gehört einerseits zum Bild, das wir vom brotlosen, leidenden Künstler haben; andererseits hinterfragen wir es nicht, wenn JK Rowling Millionen scheffelt oder eben Bananenschalen und unsichtbare Skulpturen für Millionenumsätze sorgen.
Kulturbudgets werden zusammengestrichen und wenn überhaupt, muss Kunst einfach zu konsumieren sein und dem Mainstream entsprechen. Und was dem Mainstream entspricht, ist dann auch keine Kunst mehr, zumindest laut Feuilleton der FAZ, die gern über kommerziell erfolgreiche Genres ablästert.
„Wenn du mit deiner Arbeit kein Geld machen kannst, dann musst du sagen, dass es Kunst ist; und wenn du Geld machst, sagst du, dass es etwas ganz anderes ist.“
Andy Warhol
Der oder die Künstler:in steht vor dem perfekten Zwiespalt: Wir brauchen Geld, um zu leben, und wir brauchen, wie alle anderen auch, eine gewisse Planungssicherheit. Andererseits trauen wir uns kaum, Geld für unsere Kunst zu verlangen, weil das Kunst-Schaffen ja wohl Lohn genug ist und wir gar nicht anders können. Außerdem verlassen wir unsere edlen Absichten als Künstler:in, wenn wir Geld verlangen.
Was tun wir schon, während andere hart den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch sitzen? Welchen Mehrwert bietet unsere Kunst? Würde ein Friedrich Merz überhaupt verstehen, wovon ich spreche, wenn ich den Prozess des Kunst-Erschaffens einen intimen Vorgang nenne, der am Ende den Schatten meiner Seele oder meines Schmerzes in sich trägt?
Lebenskunst bedeutet, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
Postkartenspruch
Kunst „bietet“ nichts, außer vielleicht eine Einladung an den oder die Konsumierende, sich selbst zu reflektieren und selbst gesehen zu werden.
Wenn mein Schmerz und meine Seele durch mein Werk klingen, berühren sie vielleicht dich. DAS ist die Magie. Sie funktioniert nicht immer. Liegt das dann an mir, an dem Werk oder an dir?
Und was ist Kunst dann „wert“?
Dazu fällt mir ein Zitat von Francis Ford Coppola ein, das er auf Instagram gepostet hat als Reaktion darauf, dass sein Film „Megalopolis“ die goldene Himbeere für den schlechtesten Film des Jahres 2025 erhält:
In this wreck of a world today, where ART is given scores as if it were professional wrestling, I chose to NOT follow the gutless rules laid down by an industry so terrified of risk that despite the enormous pool of young talent at its disposal, may not create pictures that will be relevant and alive 50 years from now.
Francis Ford Coppola auf Instagram
Wir sind es im Kapitalismus gewohnt, Dinge zu bewerten: Filme, Bücher, Musik – alles bekommt Scores und Sterne und auch einen Preis, der je nach Score auch höher gehandelt wird. Auch der Kunstbetrieb ist davon betroffen, nur leider verwechseln wir viel zu häufig, dass es sich bei jeder Bewertung um eine individuelle Rückmeldung handelt. Ist es überhaupt möglich, ein Kunstwerk neutral zu bewerten? Kunst ist dafür ja gar nicht gemacht, wenn man jetzt mal von Marvelfilmen und Popcornkino absieht. Und sind diese Werke keine Kunst mehr, nur weil sie Millionen Menschen ansprechen?
Kunst will verbinden: Von Seele zu Seele, von Schmerz zu Schmerz. Kunst spricht die Empathie an und fördert sie – kein Wunder, dass Elon Musk und Co. sie verdrängen wollen.
Kunst und Kapitalismus
Der Kapitalismus geht nun her und legt seine Maßstäbe an, beziffert Produktionskosten, Gebühren, Marketingkosten und zu erwartenden Erlös. Die Film- und Musikindustrie setzt Milliarden an Dollars um. Auch der Buchmarkt ist noch immer stark – woher kommen denn die Ideen für Filme? Und nicht wenige Musiker finden Inspiration in Büchern und umgekehrt.
Da wir nun in der Welt leben, in der wir leben, bemessen wir ein Kunstwerk an seinem ökonomischen Ausbeutungspotenzial.
Es geht nicht darum, ob ein Werk die Seele von irgendwem berührt, sondern darum, wie viel Geld man damit „machen“ kann.
Geld ist tatsächlich nicht der Antrieb, der mich in die Kunst und zum Schreiben trieb. Wäre das so, hätte ich BWL studiert und eine Bank gegründet oder wäre Finanzbloggerin geworden. Ich behaupte mal, dass es den meisten Künstler:innen so geht: Niemand wendet sich der Kunst zu, weil er oder sie darin viel Geld regnen sieht, sondern weil es uns dahin treibt. Wir können nicht anders! Ich wollte Bücher schreiben, seit ich sechs Jahre war, aber die Vernunft rät mir bis heute, das lieber sein zu lassen, weil eine landläufige Meinung der Überzeugung ist, dass man von Kunst nicht leben kann.
So merken wir als Künstler:innen schnell, dass unsere Kunst nur dann legitim ist, wenn wir damit auch genug Geld verdienen. Sonst ist es ja „nur ein Hobby“. Diese Denke hat unsere Gehirne so nachhaltig durchseucht, dass wir anfangen, unsere Kunst selbst als Produkt zu begreifen, als Output, als etwas, das wir verkaufen müssen, denn nur kommerziell erfolgreiche Kunst ist auch „wahre“ Kunst. Und ganz schnell befinden wir uns in einer Spirale von amazon-Rezensionen, Merchandise-Produktion und Verkaufszahlen und fragen uns, wo eigentlich der Spirit hin ist, der mal irgendwann Anstoß des Ganzen war.
Geld und Kunst sind auch für Künstler:innen nicht leicht. Wie soll man an das, was man da erschaffen hat, ein Preisschild dranhängen? Verrate ich damit meine Kunst? Andererseits ist dieser Zwiespalt einer, der aus dem Kapitalismus selbst kommt. Vielleicht ist dieser Widerspruch gar nicht real, sondern nur ein Trick des Kapitalismus, um Künstler:innen als Sklaven zu halten. Was sonst sind wir für den Algorithmus von Social Media? Wenn unser „Content“ nicht gesehen wird, bezahlen wir sogar dafür, dass Meta unsere Inhalte mehr Leuten zeigt. Gleichzeitig bedienen sich Meta & Co. unserer Ideen und Werke und macht damit Milliarden von Dollars.
Stell dir eine Welt vor, die die Kunst und Künstler:innen wertschätzt. Eine Welt, in der es selbstverständlich ist, dass Kunst einen Selbst-Wert und ein Daseinsrecht hat, ganz unabhängig davon, ob ich persönlich Verständnis für eine an die Wand getackerte Bananenschale entwickeln kann, oder nicht. Stell dir vor, der Künstler hinter der Bananenschale würde für sein Werk honoriert und geschätzt und nicht in der Mainstream-Wahrnehmung als cleveres Schlitzohr gelten, das mit minimalem Aufwand einen maximalen Gewinn erzielt hat. Was, wenn wir das WIRKLICH würdigten?
Wenn wir in so einer Welt lebten, in der Künstler:innen genauso angesehen wäre wie andere Berufe, dann müssten wir uns nicht schämen oder irgendwie unwohl fühlen oder Argumente finden, wenn wir Geld für unsere Kunst verlangen oder für Live-Auftritte. Der Punkt ist nämlich der:
Auch wenn wir es hassen und uns scheiße dabei fühlen, sind wir gezwungen, Geld für das zu verlangen, was wir tun, zum einen, um Produktionskosten und Marketingausgaben tragen zu können und zum anderen, um uns Zeit und Raum zu ermöglichen, in dem wir Kunst erschaffen können.
Wir sollten uns dafür nicht schämen; wir geben unsere Seele.
Links
Teuerste Banane der Welt: https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/banane-kunst-102.html
Die unsichtbare Skulptur: https://www.sueddeutsche.de/leben/kunst-salvatore-garau-skulptur-1.5346216
TAZ: Das ist Kunst. Das kann weg: https://taz.de/Ende-der-Boheme/!6119179/
Wenn dir dieser Text gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Newsletter abonnierst oder mir auf Mastodon folgst. Es besteht auch die Möglichkeit, mich auf Steady zu unterstützen. Danke 🫶🏻.



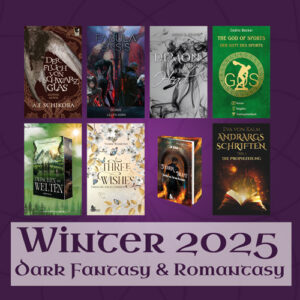
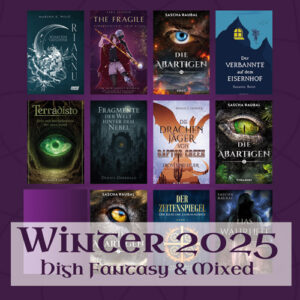



Warum sollte ich mich schämen, Geld für etwas zu verlangen, das ich erschaffen habe? Fällt mir nicht ein.
Hi Anni,
du Glückliche! Ich kenne tatsächlich so peinliche Momente und habe das auch schon von anderen Kolleg:innen gehört, dass es das gibt, z.B. bei Lesungen: Man bekommt eine Anfrage, eine Lesung zu halten und man freut sich und alles, aber irgendwie wird nicht über Geld gesprochen und es gibt nicht so wirklich die Gelegenheit, das anzusprechen, weil Kulturveranstaltung, da machen wir das ja alle ehrenamtlich. So ungefähr. In solchen Situationen erfordert es doch etwas Mut, das Thema Vergütung anzusprechen.
Und du hast völlig recht. Das sollte nicht so sein. Aber es passiert halt und es ist allen Beteiligten unangenehm. Viele fragen sich auch, wie viel sie für so etwas verlangen dürfen, ohne als unverschämt zu gelten. Bei anderen Anfragen ist das dann wieder ganz klar geregelt – auch das gibt es.
Aber ich höre es tatsächlich immer wieder und ich frage andere Autor:innen auch, ob die für Lesungen bezahlt werden und was die da so als Honorar bekommen, damit ich selbst ein Gefühl dafür bekomme.
Liebe Grüße
Sonja