Was bedeutet das eigentlich: Eine „kathartische Wirkung“? Das Thema Katharsis beschäftigt mich schon lange, sowohl im poetischen wie auch im psychologischen Sinn. Der Begriff stammt aus der griechischen Antike, genauer: Er wurde 335 v.Chr. von Aristoteles in seiner „Poetik“ geprägt und bezeichnet die „Läuterung der Seele von Leidenschaften“. Hat das für uns heute noch irgendeine Bedeutung?
Inhalt
Katharsis – Bedeutung und Definition
Katharsis bedeutet nach Aristoteles eine Art von Reinwaschung und Heilung, die Auflösung eines (inneren) Konflikts:
„Die Tragödie ist die Nachahmung einer […] Handlung […], die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt.“
(Aristoteles „Poetik“, zitiert nach Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 315)
Schon Aristoteles hat erkannt, dass Kunst maßgeblich dazu beiträgt, Menschen emotional durchs Leben zu helfen. Gut 2000 Jahre später in der Coronakrise spüren wir weltweit schmerzlich, wie wichtig uns Musik, Bücher und Filme sind – Geschichten, die uns mental über Wasser halten.
Die Psychologie hat den Begriff der Katharsis übernommen. Auch eine Therapie hat sich, grob vereinfacht, das Ziel gesteckt, eine Katharsis zu erreichen, also die Auflösung eines inneren Konflikts – ich behaupte nicht, dass das immer oder gar einfach gelingt! Mein Schwerpunkt ist die Literatur, nicht die Psychologie. Was ich interessant finde, ist, dass in der antiken Dramentheorie die Notwendigkeit einer Katharsis für den Menschen vorausgedacht wurde!
Schon bei Aristoteles war klar: Durch Stellvertreterhandlungen (auf der Theaterbühne) werden Emotionen beim Publikum erreicht und gelöst, sodass das Publikum diese gelernte Emotionsüberwindung auch im Alltag einsetzen kann. Das finde ich enorm wichtig, denn es unterstreicht auch heute noch, warum Kunst so wichtig ist!
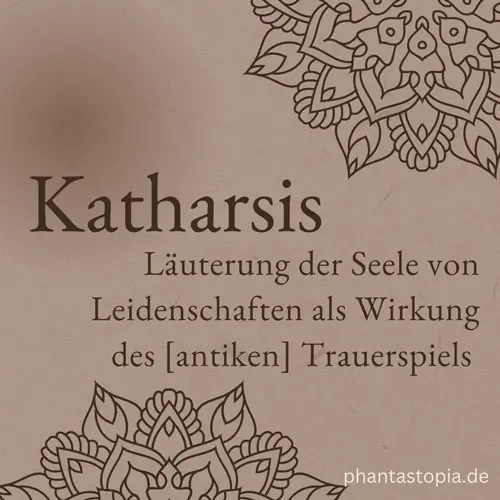
Katharsis und Schreiben
In der Autorenbubble auf Instagram, in der ich mich sehr aktiv bewege, werden immer wieder harte (emotionale) Themen angesprochen. Viele – darunter auch ich – verarbeiten mit ihrem Schreiben persönliche Erlebnisse, Schicksalsschläge, Missbrauch, Depressionen, Trauer und Verlust. Accounts wie @jan.michalsky_storyteller, @d_snow_author und viele andere sprechen regelmäßig tiefgreifende Fragen an, bei denen ich zu jeder einzelnen ganze Enzyklopädien verfassen könnte.
Eine wichtige Erkenntnis ist: Das Schreiben ist keine graue Theorie, sondern kann ein Weg zur Katharsis für Schreibende sein; zugleich werden Protagonist:innen auf Heldenreisen und Abenteuer geschickt, bei denen sie Konflikte meistern müssen. Der Weg eines Helden oder einer Heldin führt idealerweise zu einer Katharsis:
- der Ring wird zerstört und Mittelerde gerettet
- Voldemort wird besiegt und die Welt der Zauberer befreit
- das Liebespaar kommt endlich zusammen
- Angst wird überwunden
- der Mörder wird überwunden
Es gibt eine Vielzahl von Ausgangsmöglichkeiten, die mit ihren Genres variieren, und es gibt auch verschiedene kathartische Effekte: Es gibt immer eine persönliche Katharsis für den oder die Protagonistin und ihre Mitstreiter:innen, und es gibt eine mehr globale Katharsis: Beim „Herrn der Ringe“ gibt es eine Katharsis für Frodo und für Mittelerde.
Das dicke Ende kommt zum Schluss? Happy Ends und Katharsis
Es gibt Bücher, in denen das Ende nicht ganz rund ist. Wo noch irgendwas offen ist. Ich finde das sehr schade, denn es gilt ja nicht nur, eine Geschichte irgendwie zum Ende zu bringen, sondern eine kathartische Wirkung zu erzielen – ein Ende, mit dem Autor, Leser und Figuren leben können. Das muss gar kein Happy End sein!
Neulich las ich: Eine Scheidung ist erst dann vollkommen, wenn beide Parteien sich konfliktfrei wieder begegnen können. So ist es auch mit Büchern: Solange da noch irgendwas offen ist, ist es nicht vorbei!
Was Bücher angeht, so heißt es: Der Klappentext verkauft dein erstes Buch, das Ende das zweite! Das Ende muss zum Buch passen. Lose Ende müssen vernäht sein, der oder die Prota müssen ein Level weiter sein in ihrer persönlichen Entwicklung.
Wenn wir eine Geschichte plotten, so gibt es doch immer einen zu lösenden Konflikt, eine zu erreichende Katharsis. Mein Prota George aus dem Projekt Halbdämon hat noch eine lange Reise vor sich, bevor er sie erreichen wird, aber für mich steht fest: Es wird ein Ende geben, mit dem er und auch Leser:innen gut weiterleben können. Ich finde das ganz wichtig, denn ich will, dass meine Leser:innen sich in meinem Buch „sicher“ fühlen, auch wenn es zwischendurch tiefe Abgründe und ausweglose Situationen gibt.
Dabei geht es mir nicht um ein absolut glückliches Ende, sondern darum, dass die Figuren sich hinsetzen und zurückschauen können, ohne dass da noch irgendwas offen ist. Sie müssen gut mit dem Erlebten leben können und ihren Frieden gefunden haben. Das ist das, was James Scott Bell im folgenden Zitat beschreibt – sein Büchlein „The last 50 pages“* empfehle ich ganz dringend als Lektüre:
If there’s one word that sums up the feeling readers crave in an ending, it’s satisfaction. […] this positivity does not only refer to the feeling one gets after a „happy“ ending. It also means that the ending feels right for that story.
aus: James Scott Bell, The last 50 pages, S. 4.
Wie ist das bei euch? Macht ihr euch Gedanken darüber, wie ihr eure Held:innen und Leser:innen „entlasst“? Und an alle Lesenden: Bei welchem Buch hat euch das Ende besonders gut gefallen oder auch gerade nicht gefallen und warum? Ich bin gespannt!
Buch- und Lesetipps
Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie: Ansätze – Personen – Grundbegriffe*
James Scott Bell: The Last 50 Pages*
affiliate Links: Dieser Text enthält Partnerlinks, so genannte affiliate Links. Das bedeutet: Wenn du darüber etwas kaufst, erhalte ich eine kleine Provision, ohne dass dir dadurch Mehrkosten entstehen. Die Links sind mit einem * gekennzeichnet.









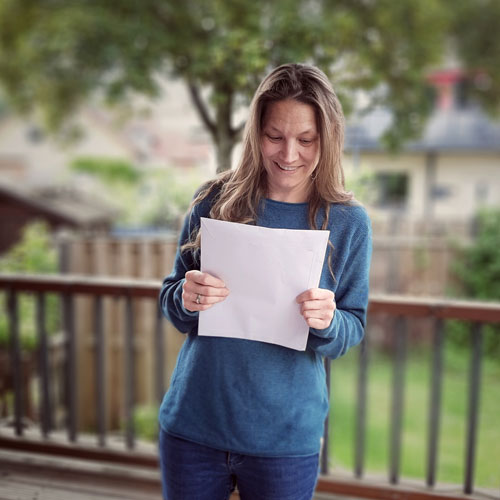
Katharsis
Was den Begriff Katharsis betrifft, siehe auch die Nereide Galene: „Die von Unruhe befreite“
„Mit dem Begriff Galene ist eine von Unruhe befreite, in sich erfüllte Seele gemeint. In der Klassik ist eine solche Seele überdies von Affekten und Verwirrungen befreit. Gemäß Platon >> handelt es sich dabei um den Zustand, in dem die Seele in das Göttliche zu schauen vermag. Dabei ist die Galene die Wirkung der Katharsis. Die Katharsis (altgriechisch κάθαρσις kátharsis = deutsch -> „Reinigung“) definiert sich aus der Tragödie >>. Das Durchleben von Jammer >> / Rührung und Schrecken >> / Schauder führt demnach zur Reinigung der Seele. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Läuterung der Seele.“
Website zum Thema Galene: https://www.mythologie-antike.com/t1245-nereide-galene-mythologie-von-unruhe-befreite-seele-windstille